Lineare FEM Simulationen
Die lineare Simulation befasst sich mit der Statik eines ruhenden Systems. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass keine zeitliche Veränderung der wirkenden Kräfte existiert oder diese vernachlässigbar klein ausfällt. Es werden alle Kräfte und deren Auswirkungen als Spannungen und Verschiebungen in Relation zum Gleichgewichtszustand bewertet.
Wann ist die lineare FEM Simulation sinnvoll?
- Wenn Sie Produkte auslegen möchten, die Größe, Dicke und Gestaltung unklar sind.
- Wenn Sie die genannten Eigenschaften optimieren möchten (Stichwort: Gewichtseinsparung),
- Wenn Sie wiederkehrende Reklamationen oder Versagensbilder erkennen und diese beseitigen möchten.
- Wenn Ihr eingesetzter Werkstoff sich linear verhält (metallische Werkstoffe im reversiblen Bereich).
Wie funktioniert die Simulation?
Ohne zu tief in die theoretischen Grundlagen der Mechanik zu gehen, kann der Ablauf wie folgt erklärt werden.
Mit geeigneter CAD-Software kann ein geometrisches Modell in Form von STP-Daten eingelesen werden. Es werden Randbedingungen definiert wie z.B. Festlager (wo wird das Bauteil gehalten?) und Kräfte (welche Kräfte wirken auf das Bauteil?)
Anschließend kann dem Bauteil ein Materialverhalten zugrunde gelegt werden. Die meisten gängigen Werkstoffe sind in der Datenbank bereits enthalten und fließen so mit der Spannungs-Dehnungs-Kurve in die Berechnung ein. Die Berechnung wird gestartet und der Solver der CAD-Software löst die Rechnung auf.
Resultate und Deutung
Es erfolgt eine bildliche Darstellung mit den entstehenden Spannungen des Bauteils (s. Gif-Animation unten). Spannungsspitzen so wie kaum belastete Bereiche lassen sich auf einem Blick erkennen. Übersteigt die Spannung die Fließgrenze Rp0,2 des eingesetzten Materials, ist Ihr Bauteil für die gegebene Belastung zu schwach ausgelegt. Es wird sich plastisch (nicht reversibel) verformen.
Schließlich können Sie anhand der Schaubilder gezielt die Schwachstellen konstruktiv beseitigen. Optional können Sie an nicht belasteten Bereichen Ihr Bauteil ausdünnen um Material/Gewicht zu sparen. Als Konstrukteur kann ich Ihnen bei diesen Schritten helfen.
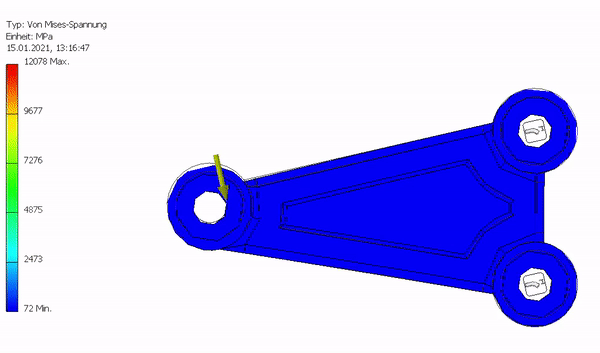
Nicht-Lineare FEM Simulationen
Die nicht-lineare Simulation ist notwendig, wenn nicht-lineare Effekte auftreten.
Diese können zum Beispiel geometrische Nichtlinearitäten sein. Diese treten auf, wenn eine sehr große Verformung auftritt. Das plastische Materialverhalten ist ein solcher Effekt. Metalle weisen oft einen lineare reversibles Verhalten bis zur Fließgrenze Rp0,2 auf. Diese dient oft als Grenze der Bauteilsicherheit. In diesem Fall könnte das o.g. lineare Verfahren helfen. Möchte der Anwender jedoch seine Bauteile bei einem metallischen Werkstoff bis zur Zugfestigkeitsgrenze Rm auslegen, ist die nicht-lineare Simulation notwendig. Ein weiteres Beispiel sind Kunststoffe. Diese enthalten einen kaum lineares Verhalten und gehen schnell oder sofort in den nicht-linearen Bereich über, weshalb bei diesem Werkstoff nur die nicht-lineare Simulation Sinn ergibt.
Ein weiterer Effekt, den die nicht-lineare Simulation abdecken kann, sind die Kontakteffekte zwischen mehreren Bauteilen. Durch das abstützen oder zusammenprallen mehrerer Bauteile können sich die Krafteinflüsse im System schlagartig ändern, welches eine nicht-lineare Betrachtung notwendig macht.
Wann ist die nicht-lineare FEM Simulation sinnvoll?
- Wenn Sie Produkte auslegen möchten, die sich über die Fließgrenze hinaus belasten lassen sollen.
- Wenn Sie im nicht-linearen Kontext die Geometrie optimieren möchten (Stichwort: Gewichtseinsparung),
- Wenn Sie wiederkehrende Reklamationen oder Versagensbilder erkennen und diese in Folge von Kontak-/Sturz entstehen (Falltest; Droptest)
- Wenn Ihr eingesetzter Werkstoff sich nicht-linear verhält (Kunststoffe)
Wie funktioniert die Simulation?
Ohne zu tief in die theoretischen Grundlagen der Mechanik zu gehen, kann der Ablauf wie folgt erklärt werden.
Mit geeigneter CAD-Software kann ein geometrisches Modell in Form von STP-Daten eingelesen werden. Es werden Randbedingungen definiert wie z.B. Festlager (wo wird das Bauteil gehalten?), Kräfte (welche Kräfte wirken auf das Bauteil?), Kontakte (Zusammenprall, Falltest, Reibung) und schließlich die Zeitinkremente, in denen die Belastung auftritt (schneller Zusammenstoß, langsamer Zusammenstoß).
Anschließend kann dem Bauteil ein Materialverhalten zugrunde gelegt werden. Die meisten gängigen Werkstoffe sind in der Datenbank bereits enthalten und fließen so mit der Spannungs-Dehnungs-Kurve in die Berechnung ein. Es kann auch eine nicht-lineares Materialverhalten eines Kundenmaterials eingelesen werden. Die Berechnung wird gestartet und der Solver der CAD-Software löst die Rechnung auf.
Resultate und Deutung
Es erfolgt eine bildliche Darstellung mit den entstehenden Spannungen des Bauteils (s. Gif-Animation unten). Spannungsspitzen so wie kaum belastete Bereiche lassen sich auf einem Blick erkennen. Übersteigt die Spannung die Zugfestigkeit Rm des eingesetzten Materials, ist Ihr Bauteil für die gegebene Belastung zu schwach ausgelegt. Es wird sich versagen bzw. bersten.
Schließlich können Sie anhand der Schaubilder/Animationen gezielt die Schwachstellen konstruktiv beseitigen. Optional können Sie an nicht belasteten Bereichen Ihr Bauteil ausdünnen um Material/Gewicht zu sparen. Als Konstrukteur kann ich Ihnen bei diesen Schritten helfen.
Ein Beispiel aus der Praxis:
Im Zuge der steigenden Internet-Käufe sehen sich die Hersteller von Kunststoffartikeln immer wieder mit Reklamationen konfrontiert, wo durch den strapazierenden Paketversand Ihre Artikel versagen. Um der Problematik entgegenzuwirken, testen viele Hersteller ihre Artikel in bestimmten Falltests im Labor. Sie versuchen durch die Schadensbilder nach dem Falltest ihre Artikel für den Online-Versand zu optimieren. Bevor Sie jedoch einen neuen Artikel aufwendig Produzieren (Werkzeugkosten) und den Labortest durchführen, könnte eine nicht-lineare Fallanalyse bereits erste Schwachstellen des Artikel-Designs erkennen und iterativ beseitigen.
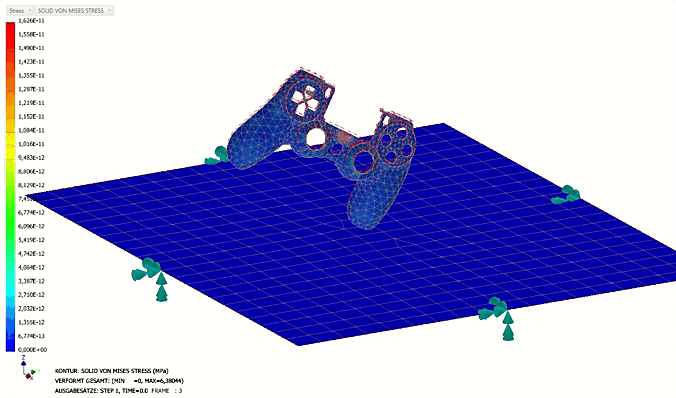


 Scan mich für die vCard!
Scan mich für die vCard!